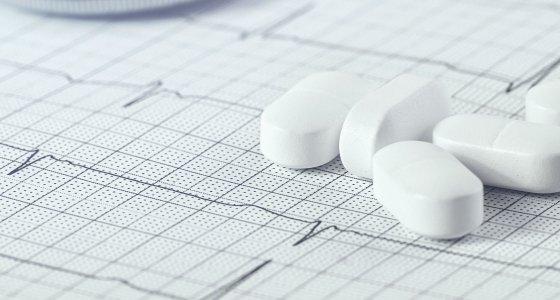Angeborene Herzfehler: Ungünstige Erfahrungen mit direkten oralen Antikoagulanzien
Medizin
Angeborene Herzfehler: Ungünstige Erfahrungen mit direkten oralen Antikoagulanzien
Dienstag, 1. Dezember 2020
/taniasv, stock.adobe.com
Münster – Die relativ neuen direkten oralen Antikoagulanzien wie Apixaban, Dabigatran, Edoxaban oder Rivaroxaban, die in den letzten Jahren aufgrund von randomisierten kontrollierten Studien zur Prophylaxe venöser Thromboembolien bei Vorhofflimmern oder nach Operationen eingeführt wurden, werden zunehmend auch bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern eingesetzt, wo keine derartigen Prüfungen durchgeführt wurden.
Eine Auswertung von Versichertendaten im European Heart Journal (2020; DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa844) kommt zu dem Ergebnis, dass die Risiken möglicherweise höher sind als angenommen.
Menschen mit angeborenen Herzerkrankungen benötigen einen Schutz vor thrombotischen Komplikationen, weil sie künstliche Herzklappen tragen oder weil es im Rahmen der Erkrankung zu Herzrhythmusstörungen gekommen ist.
Die Indikation wird offenbar zunehmend großzügiger gestellt, denn der Anteil der Patienten, die orale Antikoagulanzien erhalten, ist zwischen 2005 und 2018 von 6,3 auf 12,4 % gestiegen. Früher wurden die Patienten in der Regel mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) wie Phenprocoumon behandelt.
Die Behandlung ist sicher, sofern regelmäßige Kontrollen der Blutgerinnung erfolgen und Ärzte und Patienten auf die zahlreichen Interaktionen achten, die sich aus der gleichzeitigen Einahme anderer Medikamente und aus einer Änderung der Ernährungsgewohnheiten ergeben können.
Hier liegt ein theoretischer Vorteil der direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK). Da sie weniger anfällig für Wechselwirkungen und Schwankungen in der Wirkung sind, entfällt die Notwendigkeit einer regelmäßigen Gerinnungskontrolle. Allerdings können Dosisanpassungen, etwa im Fall einer Verschlechterung der Nierenfunktion, notwendig werden. Eine Überdosierung kann jedoch zu schweren Blutungen führen, was die Nutzen-Risiko-Bilanz der Mittel gefährden könnte.
Genau hierfür hat ein Team um Gerhard-Paul Diller vom Universitätsklinikum Münster jetzt Hinweise gefunden. Der Experte für angeborene Herzfehler bei Erwachsenen und Klappenerkrankungen hat die Daten der Barmer Krankenversicherung von rund 44.000 Patienten analysiert.
Auffällig ist zunächst ein starker Anstieg in der Zahl der Patienten, die mit DOAK behandelt wurden. Im Jahr 2018 lag der Anteil an allen Patienten, die orale Antikoagulanzien erhielten, bei 45 %, obwohl eine günstige Nutzen-Risiko-Bilanz nicht wie beim Vorhofflimmern oder in der postoperativen Anwendung in randomisierten Studien belegt wurde und die Mittel streng genommen keine Zulassung für dieses Einsatzgebiet haben.
Die Analyse der Versichertendaten zeigt nun, dass die Risiken möglicherweise von den Ärzten unterschätzt wurden. Von den erwachsenen Patienten mit angeborenen Herzerkrankungen, die mit den DOAK behandelt wurden, erlitten im Verlauf des ersten Therapiejahres 3,8 % eine thromboembolische Komplikation.
Bei den Erwachsenen, die mit VKA behandelt wurden, waren es 2,8 %. Schwere kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) traten häufiger auf (7,8 gegenüber 6,0 %), und das Risiko von Blutungen (11,7 gegenüber 9,0 %) war ebenfalls erhöht. Die Ergebnisse deuten auch auf eine erhöhte Gesamtmortalität (4,0 gegenüber 2,8 %) hin.
zum Thema
aerzteblatt.de
- DOAK oder VKA bei Vorhofflimmern: Uneinheitliches Bild bei Schlaganfall- und Blutungsrisiko
- Vorhofflimmern: „Low-Dose“ Edoxaban schützt Hochbetagte vor Schlaganfall
- Vorhofflimmern: Katheterablation senkt Demenzrisiko
Eine retrospektive Analyse von Versichertendaten kann die erhöhte Komplikationsrate nicht belegen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ärzte die DOAK überwiegend bei Patienten mit einem erhöhten Ausgangsrisiko eingesetzt haben. Die Mediziner haben in einer adjustierten Analyse versucht, mögliche Verzerrungen herauszurechnen.
Das MACE-Risiko (adjustierte Hazard Ratio 1,22; 95-%-Konfidenzintervall 1,09 bis 1,36), die Gesamtmortalität (adjustierte Hazard Ratio 1,43; 1,24 bis 1,65) und das Blutungsrisiko (adjustierte Hazard Ratio 1,16; 1,04 bis 1,29) blieben in dieser Analyse auch langfristig erhöht.
Die Forscher sind sich bewusst, dass die Analyse das erhöhte Risiko nicht zwingend belegt. Angesichts der Zahlen sollten jedoch dringend prospektive Studien durchgeführt werden, fordern sie. Der Wegfall der Gerinnungstests könnte dazu geführt haben, dass die Patienten nicht engmaschig genug beobachtet werden. © rme/aerzteblatt.de